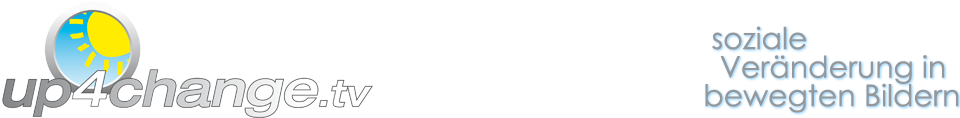Do No Harm – oder mach es nicht noch schlimmer, so heißt eine Maxime in der Entwicklungszusammenarbeit und, wer kennt es nicht aus dem täglichen Leben: Es ist doch selbstverständlich, die Konsequenzen seines Handelns VORHER zu überlegen, oder? Sollte man meinen, aber stellen Sie sich folgendes vor:
Sie sollen einen Lebensmitteltransport in ein Krisengebiet bringen, wo sich rivalisierende Bürgerkriegsparteien einen blutigen Machtkampf auf Kosten der Bevölkerung liefern. Plötzlich werden sie von Milizionären mit Waffengewalt gestoppt und stehen vor der Alternative, die Bewaffneten zu bezahlen oder, die Fahrzeuge des Konvois werden angezündet. Spontan ist die Entscheidung klar: Sie bezahlen die Milizionäre, fahren weiter und retten so Menschenleben. Leider nehmen Sie damit in Kauf, dass eine Bürgerkriegspartei unterstützt und der bestehende Konflikt weiter „gefüttert“ wird.
Basierend auf der Auswertung von realen Fällen (ähnlich dem oben beschriebenen) wurde die Studie „Do No Harm: How Aid Can Support Peace – or War“ von Mary B. Anderson 1999 veröffentlicht. Heute ist der Ansatz selbstverständlich und wird von Organisationen wie VENRO auch ständig geschult und das ist auch gut so, weil es nicht sein darf, dass gut gemeinte Hilfe in Krisenregionen Krieg, Zerstörung und Menschenrechtsverletzungen ungewollt unterstützen. Heute ist jeder NRO klar, dass Hilfe/Intervention in einem Konfliktgebiet nicht unschuldig ist. Jede Maßnahme, jeder Eingriff muss so gestaltet werden, dass der Konflikt gemildert und nicht befeuert wird. Was in Syrien, Südsudan oder Jemen angemessen ist, hat doch aber mit Kenia nichts zu tun? Unsere Arbeit im Norden des Landes ist doch eher ein Bildungsprojekt. Ist Bildung nicht per se gut? Wo soll denn im Bereich der Bildung der Konflikt sein, den man beim Do-No-Harm-Ansatz bedenken muss?
Eine UNICEF Studie aus dem Jahre 2015 mit dem Titel: „Education and Resilience in Kenya’s Arid Lands” benennt nicht nur den Konflikt, sondern beleuchtet auch die verheerenden Auswirkungen, die Bildung schaffen kann. Hier einige Thesen aus dem Bericht:
- Pastoralism is the economic mainstay of the Kenya’s arid counties, yet schools do not teach subjects relevant to pastoralism and many portray a negative image of the livelihood.
- Many school leavers feel economically and politically marginalized from the rest of Kenya.
- Most of the young people leaving secondary school are not finding secure jobs, yet feel unable to return to the rural areas. Instead many are ‘hustling’ in town.
- A rising number of young people who have been to school are turning to drugs and crime, including joining Al-Shabaab and other insurgent groups
Die Autoren kommen zu einem niederschmetternden Ergebnis, dass die staatlichen Bildungsmaßnahmen den Konflikt zwischen der nomadischen Kultur und den Anforderungen der modernen Gesellschaft nicht mildert, sondern verschärft.
Das Bildungssystem ist nicht in der Lage Analphabetismus abzuschaffen, es gibt den Schülern, die die Ausbildung abschließen nicht einmal genug Kenntnisse an die Hand, um im Wettbewerb mit den Absolventen aus anderen Teilen Kenias zu bestehen. Es wird eine Gruppe abgehängter, unzufriedener Jugendlicher produziert, die sogar als Rekrutierungsreserve für islamistische Terrorgruppen dienen.
Man kann davon ausgehen, dass die Lehrer und Schulleiter vor Ort und die Planer in den Ministerien solch negative Auswirkungen nicht erwartet hatten. Aus unserer Sicht sind sie dem Top-down Ansatz staatlicher Bürokratien geschuldet. Bildungsinitiativen, die sich als bottom-up Ansatz verstehen, können viel besser negative Auswirkungen ihrer Arbeit erkennen und sollten unmittelbar in der Lage sein, Fehlentwicklungen zu verhindern. Wir hoffen, dass wir mit unserem eeem.org Ansatz die Pastoralisten in ihrer Kultur und Lebensweise stärken.
Uli Schwarz und Petra Dilthey